Sssssssss… Im Halbschlaf höre ich das unerbittliche Summen des Moskitos neben meinem Ohr.
Ssssssttt!!! Abrupte Stille, als es sich auf mein Gesicht setzt. Bei dem Versuch es mit der Hand vom Gesicht zu wischen, haue ich mir selbst auf die Wange. Nun bin ich wach und stelle fest, dass ich mich wohl im Schlaf auf das Moskitonetz gewälzt haben muss, es daraufhin von der Decke gerissen wurde, nun auf mir drauf liegt und seinen Zweck somit natürlich gänzlich verfehlt. „Malaria, Ahoi!“ denke ich, während ich mich aus der Gefangenschaft des Netzes befreie und im Halbdunkel nach meiner Solarlampe taste. Auf dem Weg ins Bad versuche ich barfüßig den Bierdeckel-großen schwarzen Spinnen auszuweichen, die nachts aus allen erdenklichen Ritzen des Hauses kriechen, sich auf die Lauer legen und im schwachen Kegel der Lampe nun noch bedrohlicher aussehen. Doch die Räuber und ich haben einen Deal: Ich lasse sie leben und sie fressen bitteschön meine Moskitos! Dass sie ihren Part dabei nur sehr unzuverlässig erfüllen, liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Wohnung nachts zusätzlich zum Jagdgebiet kleiner Geckos wird, die, als natürliche Fressfeinde der Spinnen, meinen ausgefeilten Plan durchkreuzen und ihren Platz in der Nahrungskette verteidigen. Noch etwas schlaftrunken drehe ich mich nach meiner Morgentoilette zum Spülkasten und drücke den Hebel. Nichts passiert. „Ach, Sambia!“ Mit einem routinierten Griff hebe ich den unbefestigten Deckel des Spülkastens, rüttle an einem Plastikstück und höre erleichtert, wie plötzlich Wasser nachläuft. Zufrieden stapfe ich zurück ins Bett. Am Horizont wird es langsam hell und die warmen Sonnenstrahlen kündigen einen heißen Tag an. „Nur noch eine halbe Stunde“, denke ich und kuschle mich wieder ins Bett. Wenige Sekunden später höre ich ein kontinuierliches Plätschern aus dem Badezimmer. „Na toll, entweder er läuft nicht voll oder er läuft über.“ Genervt marschiere ich zurück ins Bad und trockne den Wasserfall in der Toilette durch erneutes Rütteln am Plastikteil aus. Ein Blick auf die Uhr verrät, dass ich nun vernünftigerweise auch gleich wach bleiben und frühstücken kann.
In der Küche fällt mein Blick auf eine schmale, schwarze, sich bewegende Linie, die einmal quer durch den Raum verläuft: Ameisen! Ich verfolge das am offenen Fenster beginnende Gewusel, über die Wand hinunter auf die Arbeitsplatte, an der Kante zwischen Platte und Wand entlang, über drei Seiten des Raumes, hinunter auf den Boden und einen halben Meter weiter an der Kante des hüfthohen Kühlschranks wieder hinauf bis auf die obere Fläche – zu meinem Obstvorrat. Spaßeshalber schiebe ich ein Glas zwischen die Ameisenstraße und beobachte fasziniert, wie sich die zwei Spuren, nach einem kurzen Moment der Verwirrung, ihren Weg um das unerwartete Hindernis bahnen und wie eine Armee disziplinierter Soldaten in Reih und Glied weitermarschieren.
Im Kühlschrank, der diesen Namen eigentlich nicht verdient, erwartet mich ein gewohnter Anblick. Welcher südkoreanische Samsung-Mitarbeiter auch immer dieses Kühlschrankmodell entwickelt hat, er hat die Praktikabilität des Geräts mit Sicherheit nicht in einem Entwicklungsland mit instabiler Stromversorgung getestet. Ansonsten wäre ihm nämlich aufgefallen, dass das integrierte Gefrierfach den Kühlschrank regelmäßig in ein Schwimmbad verwandelt. Aufgrund der stundenlangen Stromausfälle wird das nach unten offene Gefrierfach ein- bis zweimal am Tag automatisch abgetaut und beregnet alles, was in den Fächern darunter gelagert wird. Somit wird das Gemüseschubfach täglich zum Massengrab, denn während die Ameisen die warmen Stunden nutzen um sich einen Weg zu den Köstlichkeiten zu bahnen, erfrieren sie, sobald der Kühlschrank mit dem zurückkehrenden Strom seinem Namen wieder gerecht wird.
Ich nehme ein hartgekochtes Ei aus der Kühlschranktür, schäle es und muss überrascht feststellen, dass die Ameisen im Kühlschrank offensichtlich durch das kleine Loch, das beim Anstechen entstanden ist, in das Ei gekrochen sind um dort ihren Mordsappetit zu stillen. „War wohl eher ein Selbstmordsappetit“, denke ich, schneide die untere Kante des Eis ab und schiebe mir den Rest in den Mund.
Nach einem ausgiebigen Frühstück mache ich mich zu Fuß auf den Weg in die Stadt. Ich stecke mir meine Kopfhörer ins Ohr, nicht weil ich Musik oder BBC hören möchte, sondern vielmehr als Präventivmaßnahme: Mit der Kopfhörer-Methode lässt sich die Wahrscheinlichkeit, auf meinem 30-minütigen Weg in die Stadt in ein Gespräch verwickelt zu werden, deutlich herabsetzen. Zudem ist sie eine willkommene Entschuldigung dafür, die konstanten Rufe von Obstverkäufern, Taxifahrern und Bauarbeitern oder die nervigen Pfiffe von 40 Männern, eingepfercht auf der Ladefläche eines LKWs, einfach zu ignorieren. Mein antisoziales „Ich verstehe dich nicht und ich möchte dich auch nicht verstehen“-Signal hält jedoch nicht jeden davon ab, mich dennoch anzusprechen. „Hey, wie geht’s?“ In meinem Augenwinkel taucht ein Mann auf. Ich nehme einen Kopfhörer heraus und sage: „Gut, danke!“ Während er Schwierigkeiten hat mit meinem Tempo Schritt zu halten fragt er: „Wohin gehst du?“ „Einkaufen“, antworte ich knapp, immer noch meinen Kopfhörer in der Hand haltend. Er übersieht all meine Signale oder ignoriert sie bewusst. „Bist du verheiratet?“ „Ah, daher weht der Wind“, denke ich und halte einen Moment inne. Ab hier kenne ich den Gesprächsverlauf nur zu gut und viele andere Konversationen dieser Art haben mich gelehrt, dass es eigentlich vollkommen egal ist, was ich nun antworte. Wenn ich sage, dass ich verheiratet bin, werde ich gefragt, ob ich nicht zusätzlich einen Boyfriend brauche. Wenn ich sage, dass ich einen Boyfriend habe, werde ich gefragt, ob ich nicht zusätzlich eine Affäre möchte. „Ich bin single und nicht daran interessiert irgendwen kennenzulernen!“, antworte ich mit Nachdruck. „Aber wir könnten uns doch trotzdem mal auf ein Date treffen?“, schlägt er vor. Stirnrunzelnd schaue ich ihn an und frage mich: „Habe ich mich undeutlich ausgedrückt? Wie direkt muss ich denn noch werden?“ Langsam scheint er zu realisieren, dass ihm alle Felle davonschwimmen und so beschließt er kurzerhand All-In zu gehen: „Ich wollte schon immer eine weiße Frau heiraten!“ Ich breche in schallendes Gelächter aus. „Na herzlichen Glückwunsch, Frau Huber! Ein Heiratsantrag zwischen Schlaglöchern und Plastikmüll auf der Basis ihrer Hautfarbe! Romantischer hätten Sie sich diesen Moment wohl kaum erträumen lassen!“, denke ich zynisch und antworte: „Vielen Dank für dein Angebot aber ich bin weder an einem Date, noch an einer Hochzeit interessiert und ich würde jetzt gerne einfach alleine weiterlaufen und Musik hören!“ Ich bin heute nicht in der Stimmung die anschließende Diskussion zu führen. Ihn zu fragen, warum ich ihn denn heiraten sollte, wenn ich doch nun wüsste, dass der einzige Grund meine Hautfarbe und meine Staatsangehörigkeit wäre. Wie er sich diese Ehe denn vorstellen würde? Was er denn dazu sagen würde, wenn ich keine Lust hätte zu waschen, zu putzen und zu kochen, sondern anstatt dessen betrunken mit Kumpels um die Häuser ziehen würde? Ich erspare mir eine Lektion darüber, dass Menschen die weiß sind nicht zwangsläufig auch reich sind. Ebenso verkneife ich mir den Kommentar: „Du würdest dich umgucken mit einer weißen Frau, die könntest du gar nicht handeln!“ Als er einige Meter weiter immer noch keine Anstalten macht mich in Ruhe zu lassen, sondern dazu ansetzt das Gespräch fortzuführen, bleibe ich abrupt stehen. Ein paar Schritte später bleibt auch er stehen und wendet sich zurück. Ich wünsche ihm einen schönen Tag, stecke mir meine Kopfhörer wieder in die Ohren und wechsele die Straßenseite.
Einige Erledigungen später beschließe ich in einer der lokalen Imbissbuden am Straßenrand zu Mittag zu essen. Durch einen kitschigen Türvorhang betrete ich einen halbvollen Raum mit kleinen Tischen, bunten chinesischen Plastikstühlen und einem alten Fernseher in der Ecke, in dem die Highlights des vergangenen Premier League Spieltages rauschen. Ich setze mich hin und warte. Die zwei jungen Frauen hinter der Theke haben mich zwar bemerkt, führen ihre hitzige Diskussion aber ungestört weiter. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt eine der beiden an meinen Tisch und reicht mir die Karte. Ob ich denn schon wüsste was ich trinken möchte, fragt sie. Unentschlossen fällt mein Blick auf die riesige Coca Cola Werbung mit der die Wände des Restaurants tapeziert sind. Spontan alle Prinzipien über Bord werfend bestelle ich eine Cola. „Haben wir im Moment leider nicht“, entgegnet sie. „Hmm, dann eben nur ein Wasser.“ Sie nickt, schlurft zurück zur Theke und widmet sich wieder ihrem Klatsch und Tratsch. Ich studiere die Karte, entscheide mich für Fisch mit Reis und Gemüse und winke schließlich der Kellnerin zu. Sie nimmt meine Bestellung auf und verschwindet in der Küche. Mein Blick bleibt am Fernseher hängen, der jetzt den neusten Videoclip eines südafrikanischen Rappers zeigt. Neben einem Pool voller Dollarscheine räkeln sich 3 halbnackte Frauen auf der Motorhaube eines gelben Lamborghinis. Während ich beobachte wie die anderen Gäste am Bildschirm kleben, sehe ich die Bedienung auf mich zukommen. „Das ging aber überraschend schnell“, denke ich, als ich realisiere, dass sie gar keinen Teller in der Hand hat. „Es tut mir leid, wir haben keinen Fisch“, sagt sie und schaut mich bedauernd an. „Schade, aber dann nehme ich die Pasta mit Pilzsauce.“ Als sie sich zum Gehen wendet füge ich hinzu: „Könntest du mir das Wasser vielleicht schon bringen?“ Als ich schließlich alles über die jüngsten Millionentransfers einiger Topspieler und den heißesten Gossip der Kardashians weiß, kommt die Kellnerin erneut an meinen Tisch. „Wir haben leider auch keine Pilze.“ Ich ziehe die Augenbrauen hoch und denke: „Ach, und das erfahre ich 20 Minuten später?“ Nach über drei Jahren in der Gastronomie bin ich eigentlich ziemlich nachsichtig mit anderen Servicekräften, weil ich weiß, wie es hinter den Kulissen zugeht. Allerdings habe ich – Bildungsniveau, kulturelle Differenzen und Unterbezahlung hin oder her – trotz aller Widrigkeiten absolut kein Verständnis für Trödelei und Unfreundlichkeit! „Okay, könnte ich dann nochmal kurz einen Blick in die Karte werfen?“ Stumm geht sie zurück zur Theke, bringt mir das Menü und endlich auch mein Wasser. Mit knurrendem Magen lese ich die 22 Gerichte noch einmal und überlege mir welche Zutaten sie wohl haben könnten. Schließlich winke ich ihr erneut zu und warte bis sie in aller Gemütsruhe auf mich zu schlappt. „Habt ihr denn das indische Curry?“, frage ich hoffnungsvoll. „Falls nicht, bring mir einfach irgendetwas, das ihr habt. Nshima mit Gemüse oder so.“ In der Gewissheit, dass jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen kann, lehne ich mich zurück und widme mich dem trällernden Gesang eines offensichtlich um seine verflossene Liebe weinenden Bollywoodstars. Als ich gerade darüber nachdenke, dass ich schon vor 20 Minuten hätte gehen sollen, erscheint die Bedienung erneut neben mir und fragt: „Ist Nshima, Spinat und Bohnen in Ordnung?“ Genervt antworte ich: „Ja, ist mir egal, ich habe Hunger, bring mir einfach irgendwas, Hauptsache es geht schnell!“
Den Nachmittag verbringe ich in einer schicken Hotellobby und halte mich, zur offensichtlichen Freude des Personals, stundenlang an einem italienischen Cappuccino fest, um deren kostenloses W-Lan zu nutzen. Gerade noch der Schoko-Brownie-Versuchung widerstanden, verlasse ich schließlich das Café und mache mich auf den Weg zum Minibus-Stop. Als ich mich ein paar Obst- und Gemüseständen am Straßenrand nähere, sehe ich wie mir eine junge Frau schon von weitem freundlich zuwinkt. Einen traditionellen Chitenge-Rock um die Hüfte gewickelt, ein Baby auf den Rücken gebunden und einen riesigen Korb Bananen auf dem Kopf balancierend, dreht sie sich zu einer Horde Kinder und ruft ihnen etwas zu. Sekunden später rennen die Kinder winkend und schreiend auf mich zu. „Mzungu, Mzungu!“ Sie umkreisen mich und mustern jedes Detail meiner Fremdartigkeit. Meine Kleidung, meinen Rucksack, meine Frisur, meine Hautfarbe. Die Schüchternen gucken mich nur mit großen Augen an, die Mutigen wollen mir die Hand geben und die Frechen zwicken mir einfach in den Arm. „How are you? What’s your name? Where are you from?“ Ich blicke in ein Duzend neugierige Kinderaugen und beantworte geduldig all ihre Fragen. Sie kichern und quieken, eines ist schöner als das andere und ich kann mich gar nicht entscheiden, welches ich als erstes adoptieren möchte. Doch schon nach wenigen Höflichkeitsfloskeln springen sie zum zweiten Kapitel des Fragenkatalogs: „Money, Money?“, „Chocolate?“, “Sweets?” „Kwacha, Kwacha?” So zuckersüß sie auch lächeln, mir vergeht schlagartig die Freude. Ich sehe die kaputten Schuhe, die zerschlissenen Hosen und T-Shirts, schmutzige Hände und ungewaschene Haare. Trotzdem merke ich wie mein Mitgefühl von Wut abgelöst wird. Wut auf all die Eltern, die ihre Kinder vorschicken, weil sie wissen, dass große traurige Knopfaugen effektivere Geldeintreiber sind. Von Geburt an lehren sie ihre Kinder möglichst mitleiderregend zu gucken um Geld zu erbetteln, anstatt sie mit Fähigkeiten auszustatten, die es ihnen ermöglichen irgendwann Geld zu verdienen. Eine weitere Generation wächst in der Gewissheit auf: Wir sind schwarz und arm; Die sind weiß und reich.
„Afrika, emanzipier‘ dich!“ Nachdem ich die Kinder barsch abgeschüttelt habe, stehe ich, mit meinen Scheuklappen in den Ohren, gedankenversunken am Straßenrand und warte auf einen Minibus. Von der Seite beobachtet mich ein Mann, ich schaue demonstrativ an ihm vorbei den Autos hinterher. Er mustert mich von oben bis unten, schaut kurz weg, starrt mich wieder an, schaut wieder weg, dann wieder her. „Kann ich nicht einfach nur mal 5 Minuten unsichtbar sein?!“ schießt es mir durch den Kopf, als ein Minibus hält, der Callboy herausspringt und wild mit den Armen fuchtelnd „Chelston-Avendale“ ruft. Ich nicke stumm und drängle mich zwischen anderen Wartenden hindurch zur Tür des Minibusses. Im Moment des Einsteigens bemerke ich plötzlich ein kurzes Ziehen an meinem Rucksack. Blitzschnell fahre ich herum, starre für den Bruchteil einer Sekunde in gelb-glasige Augen, bevor der Dieb stolpernd davon rennt und ich ihm reflexartig nur noch ein deutsches „du blöder Wixxer“ hinterher schreien kann. Der vordere Reißverschluss meines Rucksacks ist offen, mein Geldbeutel nur einen Handgriff tiefer in der Tasche. Mein Herz pocht, Schweißperlen stehen mir auf der Stirn. Begleitet von den verständnisvollen Blicken der anderen Fahrgäste quetsche ich mich, meinen Rucksack umklammernd, in den völlig überfüllten Toyota. „Puuuhh, du naiver Glückspilz, das war knapp!“
Als der Callboy vor meiner Nase mit Münzen klimpert, sage ich „UnZa“ und drücke ihm einen 5er in die Hand. Er packt ihn auf den Stapel Geldscheine in seiner Hand und kassiert dann die anderen Fahrgäste ab. Schon wenige Minuten später hält der Minibus an meiner Haltestelle, doch ich habe mein Wechselgeld immer noch nicht bekommen. Während ich aussteige frage ich nach meinem Rückgeld und zeige auf seine Hand. Der Callboy ignoriert mich und widmet sich lautstark dem Werben neuer Fahrgäste. „Chelston-Avendale, Chelston-Avendale?!“ Als er realisiert, dass ich mich nicht so einfach abspeisen lasse, drückt er mir widerwillig einen Kwacha in die Hand. Ich protestiere und erkläre ihm, dass ich drei Haltestellen mitgefahren bin, jeder Stop einen Kwacha kostet, ich ihm einen 5er gegeben habe und somit nicht nur einen, sondern zwei Kwacha zurückbekomme. An mir vorbei schauend murmelt er ein „Stell dich nicht so an, Mzungu!“, schwingt sich in die Tür, klopft zweimal gegen die Karosserie und lässt mich mit meinem Kwacha in der Hand stehen.
Ein Kwacha, das sind 8 Cent. Ich komme mir lächerlich vor, aber es geht mir nicht um die 8 Cent, es geht ums Prinzip! Warum muss ich immer und überall mehr zahlen, nur weil ich weiß bin? Warum muss ich jeden Tag dafür kämpfen, einfach nur denselben Preis zu bekommen, wie die Einheimischen? Sie regen sich über die Apartheid in Südafrika, über das Verhalten der Polizei in Amerika auf und messen gleichzeitig selbst mit zweierlei Maß. „Das ist auch Rassismus!“ schnaube ich wütend und stelle mir vor, was in Europa los wäre, wenn Schwarze einfach grundsätzlich doppelt so viel für öffentliche Verkehrsmittel zahlen müssten, wie Weiße.
Ich kann nachvollziehen, dass viele Expats, das nervenraubende Handeln, ob am Gemüsestand oder beim Taxifahren, leid sind und aus Bequemlichkeit einfach den Preis bezahlen, der ihnen genannt wird. In einem größeren Rahmen führt dieses dekadente Verhalten jedoch dazu, dass Taxipreise und Mieten auch für die lokale Bevölkerung rasant steigen, weil sie durch Internationals mit fetten Gehältern künstlich nach oben getrieben werden. Zudem manifestiert es das gängige Bild in den Köpfen: Der Weiße hat’s ja!
Von der – nennen wir es Bushaltestelle – schlendere ich zum Supermarkt, um auf dem Heimweg noch schnell meinen Frühstücksvorrat aufzufüllen. Einen Joghurt, Milch und Haferflocken in der Hand haltend reihe ich mich an der Kasse in die Schlange ein und zähle die Leute vor mir: „… 7, 8, 9. Heute ist wohl ihr Glückstag, Frau Huber!“, denke ich und stelle mich mental darauf ein, die Nacht an der Kasse einer südafrikanischen Supermarktkette zu verbringen. Von weitem beobachte ich, wie die Kassiererin in aller Gemütsruhe einen Artikel nach dem anderen über den Scanner zieht, während sie gemütlich mit einer Hilfskraft plaudert, die gleichzeitig damit beschäftigt ist die Artikel am Ende des Bandes in Plastiktüten zu verpacken. Dabei gilt offensichtlich die gute alte Walmart-Regel: Der Umweltkatastrophe zuliebe allerhöchstens 2 Artikel pro Plastiktüte!
„Ganz Afrika schaut neidisch nach Kigali, während die Länder im Plastikmüll ersticken und alle rümpfen die Nase, wenn sie an brennenden Müllbergen vorbei laufen aber Plastiktüten besteuern oder gar freiwillig das Einkaufsverhalten ändern, auf die Idee kommt keiner… Diktatur hin oder her, dieser Kagame in Ruanda hat wenigstens eine pragmatische Lösung für das Müllproblem gefunden und Plastiktüten einfach komplett verboten.“ 15 Minuten später diskutiere ich immer noch mit mir selbst darüber, ob Meinungs- und Pressefreiheit nun wichtiger ist oder Stabilität und Wirtschaftswachstum, ob die Demokratie überhaupt ein praktikables politisches System für afrikanische Staaten ist oder inwiefern ein weitsichtiger Diktator – jedenfalls in einer Übergangsphase – seinem Land vielleicht dienlicher ist als ein kurzsichtiges Volk? „Du hast Politikwissenschaften studiert, du darfst so etwas nicht denken!“, schimpfe ich mit mir selbst. „Aber wenn das Bildungssystem die Bevölkerung nicht in die Lage versetzt mit der Freiheit umzugehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, muss vielleicht einfach der Liberalismus dran glauben?!“ Während ich Teufelchen und Engelchen auf meinen Schultern nicht mehr unterscheiden kann, beobachte ich, wie sich der Scanner – 7 Personen vor mir – bei 12 von 14 abgepackten Muffins weigert das Etikett zu lesen, sodass die Kassiererin alle Zahlenkombinationen von Hand eintippen muss. 5 Personen vor mir wurden die Paprika nicht gewogen und so schlurft die Hilfskraft zurück zur Gemüseabteilung. Infolge dessen kommt der gesamte Prozess zum Erliegen, denn die Artikel stauen sich am Ende des Bandes und weil die Hilfskraft aufhörte einzupacken, hört die Kassiererin nun auf zu scannen und begutachtet anstatt dessen ihre künstlichen Fingernägel. Da der Kunde hier immer noch König ist, beschränkt sich seine Rolle darauf, den Geldbeutel zu halten und nach dem Bezahlen die 27 Plastiktüten im Wagen nach draußen zu schieben. „Hör auf so Deutsch zu sein!“ ermahne ich mich selbst. „Du solltest lernen das zu genießen!“ Ich frage mich was wohl langfristig gesünder für die menschliche Psyche ist: Sich in Geduld zu üben und ab und an einen innerlichen Nervenzusammenbruch zu erleiden, wenn man es tatsächlich eilig hat, oder regelmäßig dem künstlich erzeugten Stress in deutschen Supermärkten ausgesetzt zu sein?
Wenn du dir bei Lidl schon während du die Artikel aufs Band legst, überlegen musst, wie du sie am anderen Ende logistisch möglichst platzsparend in deinem Rucksack verstaust. Dann deinen Geldbeutel schon mal unter den Arm klemmst, deine Taschen offen in den Einkaufswagen stellst und diesen strategisch im Dreieck zwischen dir und Kasse platzierst. Jeder Handgriff wird von den Leuten in der Schlange hinter dir beobachtet. Wie am Fließband nimmst du der Kassiererin nach dem Scannen quasi die Artikel aus der Hand, verstaust sie hastig in deinen Taschen und hoffst insgeheim darauf, dass sie die Zahl eines saisonalen Gemüses noch nicht auswendig weiß, um wertvolle Millisekunden zu gewinnen und im Verlauf der Prozedur nicht abgehängt zu werden. Du bist gestresst, fängst an zu schwitzen. Zeitgleich und unter den genervten Blicken deiner deutschen Mitbürger, weil dieses Zahlverfahren 2,5 Sekunden länger dauert, kramst du schon mal die Kreditkarte aus dem Geldbeutel. Während du mit der einen Hand die Geheimzahl eintippst, wirfst du mit der anderen noch schnell die Tomaten in den Einkaufswagen, murmelst ein knappes „Danke, Tschüss“ und räumst das Feld für den nächsten Systemdiener, der sein gesamtes Einkaufsverhalten intuitiv der Strategie der Kassen-Hersteller untergeordnet hat, die den Sklaven – äh, Kunden – mit immer kürzeren Ablageflächen für die gescannten Einkaufsartikel bewusst zeitlich unter Druck setzen und somit den gesamten Prozess, zum Triumph des Kapitalismus, extrem beschleunigen.
Noch 4 Personen vor mir. „Wenn du zurück in Deutschland bist und das erste Mal wieder bei Aldi an der Kasse stehst, wirst du dir exakt diese Momente zurück sehnen!“ ermahne ich mich selbst. 3 Personen vor mir geht der Kassiererin das Wechselgeld aus. Da auch Nummer 2 nicht aushelfen kann, wird die Hilfskraft auf die schon im Vorhinein nahezu aussichtlose Mission geschickt, an einer der anderen Kassen Kleingeld aufzutreiben. Geduldig wartet der Pöbel. „Reg dich nicht auf! Ist ja nur Lebenszeit und davon hast du statistisch gesehen immerhin 1/3 mehr als der durchschnittliche Sambier.“ Ich vergleiche Kaugummipreise, frage mich ob der ranzige Hand-Sanitizer an der Kasse nicht eher Bakterien überträgt, als abtötet und inspiziere die abgefahrene Cornrow-Frisur der Frau vor mir, bis die Hilfskraft schließlich zurück kommt und schulterzuckend verkündet, dass sie diese Kasse leider schließen müssen und wir an die Nebenkasse umziehen sollten. „Wooosaah Frau Huber!“ Ich zwinge mich zu meditativem Durchatmen und folge den anderen Wartenden im Gänsemarsch an die neue Kasse, als mir plötzlich ein Mann auf die Schulter tippt und mich auffordert an ihm vorbei direkt zur Kassiererin zu gehen. Verwirrt blicke ich zu den Leidensgenossen vor mir und sehe sie ebenfalls eifrig mit den Armen auf die Pole-Position der Warteschlange zeigen. Für einen Moment bin ich sehr verleitet das Angebot anzunehmen, zögere dann jedoch und höre mich kopfschüttelnd sagen: „Nein, nein, kein Problem, ich kann genauso warten wie alle anderen!“ Obwohl das Teufelchen auf meiner Schulter meine Entscheidung unaufhörlich kritisiert, bringe ich doch die nötige Überredungskunst auf und überzeuge die Kassiererin schließlich davon, die ursprüngliche Reihenfolge ganz einfach beizubehalten. Manchmal könnte einem der Weißen-Bonus das Leben durchaus erleichtern, doch wer Gleichberechtigung im Minibus fordert, muss eben auch das laute TICK-TACK der Lebenszeit-Uhr an afrikanischen Supermarktkassen ertragen.
Als ich das Einkaufszentrum verlasse, stelle ich fest, dass die Sonne bereits untergegangen und es schon dunkel ist. Damit meine ich nicht Europa-dunkel, sondern Afrika-dunkel, richtig dunkel, stockdunkel! Ich weiß, dass ich nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr alleine draußen herum laufen sollte, doch ich rede mir ein, dass es ja noch nicht allzu spät sei und immer noch viele Menschen auf den Straßen unterwegs waren. Von einer der wenigen großen beleuchteten Straßen Lusakas, biege ich nach Kalundu ab. Ein Auto kommt mir entgegen, die Scheinwerfer blenden mich und hinterlassen ein großes schwarzes Nichts, als es vorbei fährt. Langsam gewöhnen sich meine Augen an die Dunkelheit. Im grau und grau der Nacht erkenne ich den Verlauf der Straße, die Umrisse von Grundstücken, Mauern und parkenden Autos. Ich nehme meine Kopfhörer heraus, beobachte die Schatten der Gebüsche neben meinem Weg, ich registriere jedes Geräusch hinter mir, nehme jede Bewegung in meinem Blickfeld wahr. Während ich meine Rucksackträger enger ziehe denke ich darüber nach was sich darin befindet: Laptop, Geldbeutel, Kreditkarte, Bargeld. „Wie so ein Raubüberfall wohl abläuft?“, frage ich mich. Ob sie Messer haben, oder gar Schusswaffen? Ob einen überhaupt jemand hören würde, selbst wenn man Zeit hätte zu schreien? Ich bin angespannt, mein Herz pocht, all meine Sinne arbeiten auf Hochtouren. Würde ich aus Reaktion einfach um mich schlagen, oder vielleicht einfach bewegungsunfähig erstarren? Während ich mir einen Schlüssel zwischen Zeige- und Mittelfinger klemme muss ich an die junge Frau in Dubai denken, die ihren Vergewaltiger mit ein paar gekonnten Karate-Kicks überwältigt und dann der Polizei übergeben hat. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Situation anders ausginge, nicht so groß und die Polizei hier nicht so korrupt wäre, würde dieses Szenario einer Vergewaltigung fast einen Platz auf meiner Bucket-List erhalten. Ich zucke zusammen als am Horizont ein Blitz den Himmel zerreißt und für einen kurzen Augenblick den vor mir liegenden Weg erleuchtet. Stille, dann kündigt der polternde Donner das aufziehende Unwetter an. Ein weiterer Blitz und es beginnt zu tröpfeln. Binnen weniger Minuten entwickelt sich der Nieselregen zu einem peitschenden Gewitter und die ungeteerte Sandstraße verwandelt sich in eine Matschpiste. „Wer nimmt auch weiße Ballerinas mit nach Afrika?!“, schimpfe ich mit mir selbst. Vorsichtig taste ich mich von einem Fuß auf den anderen, versuche den schwarzen Flecken, die tiefe Schlaglöcher erahnen lassen, auszuweichen. Wasser läuft in meine Schuhe, sodass ich bei jedem Schritt hin und her rutsche. Gleichzeitig versinke ich immer tiefer im Matsch. Nur noch zwei Straßenecken. An der Seite der Straße kann ich im Halbdunkel ein Stück Wiese und einige größere Steine erkennen. Ich stolpere über Baumaterial, rutsche auf dem nassen Gras fast aus und hechte mich schließlich von einer Stein-Insel zur nächsten, während sich die Straße längst in einen Wildwasserbach verwandelt hat. Völlig abgekämpft erreiche ich endlich unseren Compound und flüchte mich eilig unter das schützende Vordach. Geschafft! Für einen Moment starre ich in den sinnflutartigen Sturzbach vom Himmel, der vom Wind wie ein Schleier hin und her geweht wird. Dann schließe ich die Tür auf und greife instinktiv nach meiner Stirnlampe, wohlwissentlich dass es sowieso keinen Strom gibt. Raus aus den klatschnassen Sachen und ab ins Bad zum Duschen. Ich drehe den Wasserhahn auf, doch nichts passiert. „Ernsthaft ZESCO?!“ Nachdem wir letztes Wochenende überraschenderweise zwei Abende hintereinander Strom hatten, gibt’s dieses Wochenende also überhaupt keinen Strom – und somit auch kein Wasser. Spontan fällt mir eine durchaus logische Erklärung für die Unregelmäßigkeit ein: „Wahrscheinlich hatte ein ZESCO-Mitarbeiter letzte Woche eine Affäre mit einer Tussi in unserem Viertel und diese Woche hat es seine Frau herausgefunden.“ Na gut, dann muss eben das Notfallwasser in alten Milchflaschen dran glauben, um notdürftig wenigstens Füße zu waschen und Zähne zu putzen. Da der Toilettenspülkasten ebenfalls leer ist, versuche ich erst gar nicht meine Hände zu waschen. „Hygiene wird sowieso völlig überbewertet!“, bemerkt meine Sozialisation sarkastisch. Um der Malaria doch noch einen Strich durch die Rechnung zu machen, hänge ich das Moskitonetz wieder auf und schiebe es sorgfältig unter die Matratze. Diese – sogenannte – Matratze, die trotz einer zusammengefalteten Daunendecke in der Mitte des Lattenrosts immer noch eher einem Tal – nein – dem Afrikanischen Grabenbruch gleicht. Ich falle todmüde ins Bett, rolle mich auf eine Seite meines 90 Zentimeter breiten Rift-Valleys und schließe erschöpft die Augen… – da klingelt mein Handy.
Ein Whatsapp-Anruf aus Deutschland: „Hey, na was geht so bei dir?“
Ich hole tief Luft bevor ich antworte: „Ach du, nichts Besonderes, alles easy!“
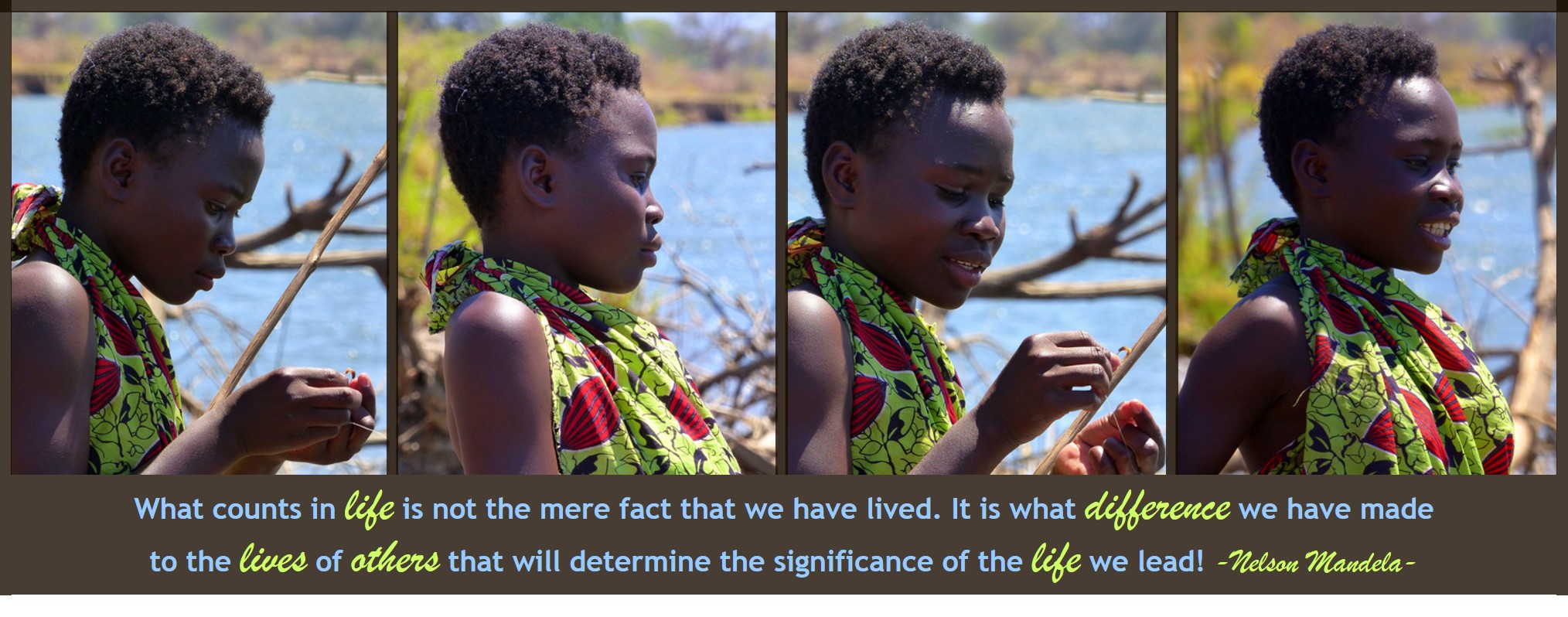
Hi Tammy, da gibt es nur einen Kommentar: genial geschrieben!
Du überlebst das und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Saludos Roland
Hallo Thamar,
Super geschrieben. Du hast da wirklich grosses Talent.
Danke.
Holger
Hi Thamy,
dem kann ich mich nur anschließen! Es war ein Vergnügen deinen Bericht zu lesen!
Danke und alles Gute, Mama